Starke chronische Erschöpfung, in medizinischen Fachkreisen oft als Fatigue bezeichnet, gehört zu den häufigsten Begleiterscheinungen vieler chronischer Darmerkrankungen. Eine Metaanalyse aus dem Jahre 2024 kommt zu dem Schluss, dass 74% der Reizdarm-, 60% der Crohn- und 53% der Colitis-Betroffenen unter moderater bis schwerer Erschöpfung leiden[1].
Dass gerade das Reizdarmsyndrom hier eine besondere Rolle einzunehmen scheint, bestätigt aber nicht nur die hohe Prävalenz des Symptoms unter nahezu einem Dreiviertel der Patienten. Denn auch unter den Betroffenen der beiden chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen berichten jene Patienten am häufigsten über lähmende Erschöpfung, welche außerhalb aktiver Krankheitsschübe von typischen Reizdarmbeschwerden geplagt werden.
Selbst für viele Mediziner mag es noch überraschend sein, aber tatsächlich ist die Erschöpfung im Rahmen des Reizdarmsyndroms neben den Bauchschmerzen und häufigen Toilettengängen eines der drei häufigsten Symptome[2]. Sie verweist damit sogar direkt mit der Verdauung assoziierte Beschwerden wie Blähungen, Verstopfung, weiche Stuhlgänge bzw. Durchfälle, Übelkeit oder das Gefühl der unvollständigen Entleerung auf ihre Plätze!
Leider stoßen die Betroffenen immer noch häufig auf Unverständnis oder Unkenntnis, wenn sie spezifisch nach Hilfe für diesen Symptomkomplex suchen. Doch selbst wenn die Ärzte kundig sind, sind diesen zumeist die Hände gebunden. Denn wie beim Chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS/ME), einer weiteren funktionellen Erkrankung, die eng mit dem Reizdarmsyndrom verzahnt ist[3], existieren bisher kaum wirkungsvolle Behandlungsansätze zur Eindämmung der Fatigue[4].
In einem vergangenen Artikel hatte ich bereits beschrieben, wie Reizdarmsyndrom und chronische Erschöpfung pathophysiologisch zusammenhängen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Behandlungsstrategien, welche auf die Hauptmechanismen der Erkrankung Einfluss nehmen, also bspw. Entzündungen lindern oder das Mikrobiom optimieren, auch das Potenzial haben, dein Energielevel zu steigern. So lindert eine Stuhltransplantation (FMT) nicht nur nachhaltig Bauchschmerzen und Durchfälle, sondern eben auch die Fatigue-Scores der Probanden[5].
Doch leider stoßen diese Interventionen immer wieder an ihre Grenzen. Was würdest du zum Beispiel sagen, wenn ich dir erklärte, dass die krankheitsbezogene Erschöpfung häufig gar nicht oder nur zu einem Teil mit den pathophysiologischen Zuständen der jeweiligen Erkrankung verknüpft ist[6][7]? Oder einfacher: Dass viele Patienten sich auch in Remissionsphasen mit der chronischen Erschöpfung herumquälen müssen[8]? Ein Problem, von dem CFS-Patienten ein Liedchen (oder eine ganze Oper) singen könnten ...
Aus diesen Gründen möchte ich heute mit dir über eine Angewohnheit sprechen, die meine eigene Regeneration (Diagnosen: MCAS; CFS; mastzellassoziierte Gastritis & Colitis) jahrelang torpediert hat: Das sogenannte Alles-oder-Nichts-Verhalten, einen besonders boshaften Drachen, der gerade in der schnelllebigen Moderne gedeihen kann.
Das Verhaltensmuster gilt in vielen Regressionsmodellen neben dem Entzündungsstatus als mächtigste Einflussvariable auf die Erschöpfung im Rahmen chronischer Darmerkrankungen.
Im folgenden Artikel werde ich dir zeigen, was das Alles-oder-Nichts-Verhalten genau ist, wie es die Regeneration deines Körpers sabotiert und warum du meine Fehler der Vergangenheit unbedingt vermeiden solltest, um schneller wieder dein persönliches Optimum zu erreichen. (Auch für CFS/ME, Fibromyalgie- und MCAS-Patienten hochinteressant!)
Inhalt - Darmerkrankungen, Alles-oder-Nichts-Verhalten und Erschöpfung.
Was ist das Alles-oder-Nichts-Verhalten?
Ich glaube, jeder Leser kann diese Tendenz der Betroffenen gut nachvollziehen oder hat diese auch schon an sich selbst beobachten können. Ein ähnliches Phänomen können wir beobachten, wenn Berufstätige aus einem längeren Urlaub oder einer Krankheitsphase zurückkehren und dadurch unheimlich viele Dinge liegen geblieben sind. Die 287 unbeantworteten E-Mails sind da noch das geringste Problem ...
Und auch für Patienten mit CFS/ME, Fibromyalgie, Reizdarm oder Morbus Crohn legt das moderne Leben natürlich keine extra Pausen ein. Soziale Erwartungen und Verpflichtungen aufgrund bestimmter Rollen (Bürger und Steuerzahler, Mutter oder Vater, Hausbesitzer oder Mieter, Angestellter oder Selbstständiger etc.) türmen sich bei Nichterledigung recht zügig zu gewaltigen Bergen auf, wenn sie aufgrund starker Symptome nicht zeitnah erledigt werden können. So gewähren im Normalfall weder das Finanzamt, noch Familie oder Arbeitgeber zeitliche Boni für Erschöpfungsgeplagte. Es klingt also mehr als einleuchtend, dass die Patienten an subjektiv besseren Tagen so viel wie möglich von diesem Pflichtenberg abarbeiten wollen. (Und aus eigener Erfahrung kann ich beisteuern: Es macht oft sogar großen Spaß - bis der Kellner am nächsten oder übernächsten Tag die Rechnung präsentiert ... )
Doch leider ist dieses intuitive und unter Patienten mit chronischer Erschöpfung weit verbreitete Verhalten extrem dysfunktional und schädlich. Schau dir dazu einmal die wissenschaftlichen Befunde im nächsten Abschnitt an!
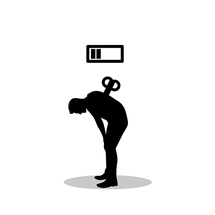
Push-Crash-Verhalten ist eine Ursache für die Entstehung chronischer Erschöpfung bzw. von CFS/ME
Heute wissen wir, dass die Entstehung eines Chronischen Erschöpfungssyndroms häufig (aber nicht immer!) durch eine akute Infektion initiiert wird. Eine zentrale Rolle spielt hierbei das EBV-Virus, welches das Pfeifersche Drüsenfieber hervorruft. Sechs Monate nach einer solchen Infektion erfüllen ca. neun bis zwanzig Prozent der Betroffenen die Kriterien für das Symptom der postviralen chronischen Müdigkeit oder Erschöpfung[11]. Diese Rate nimmt mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur akuten Erkrankung weiter ab. Zwei Jahre nach einer solchen akuten Erkrankung erhalten immerhin noch 4% der Erkrankten die tatsächliche Diagnose Chronisches Erschöpfungssyndrom bzw. CFS/ME[12].
Das klingt doch wirklich ziemlich biologisch, oder? Eine Infektion führt, im Zusammenspiel mit genetischen Prädiktoren[13], zum Chronischen Erschöpfungssyndrom. Doch hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum 96% und mehr der Bevölkerung das Pfeifersche Drüsenfieber ohne ein spätere Erschöpfungserkrankung überstehen? Die Genetik allein kann dies nämlich nicht erklären.
Es müssen sich also weitere Variablen hinzugesellen, um die Wahrscheinlichkeit für eine ungünstige Prognose nach der Infektion anwachsen zu lassen. Zu unserem Glück wurden diese Risikofaktoren in zahlreichen Assoziationsstudien und Regressionsanalysen herausgearbeitet. Zu den begünstigenden Faktoren einer CFS-Diagnose zwölf Monate nach überstandenem Pfeiferschen Drüsenfieber gehören[14]:
- Angsterkrankungen vor und während der Infektion
- depressive Verstimmungen vor und während der Infektion
- Somatisierungsneigung
- ausgeprägter Perfektionismus
- negative Krankheitsüberzeugungen (z.B. der Glaube an eine lang anhaltende und unkontrollierbare Erkrankung)
- Alles-oder-Nichts-Verhalten nach der akuten Infektion
Das hier thematisierte Alles-oder-Nichts-Verhalten im Umgang mit der typischen postviralen Müdigkeit war übrigens am stärksten mit der CFS-Diagnose viele Monate später assoziiert!
Weil es so wichtig ist, noch einmal ganz einfach ausformuliert: Nach einer Erkrankung am Pfeiferschen Drüsenfieber berichtet etwa jeder zehnte Patient über anhaltende Müdigkeit oder Abgeschlagenheit. Diese verlängerte Regenerationsphase ist normal und nicht mit einer erhöhten viralen oder Entzündungslast assoziiert. Typischerweise verliert sich diese Form der Erschöpfung nach einigen weiteren Wochen bis Monaten. Reagieren die Patienten in dieser kritischen Phase auf die Symptome mit dem Alles-oder-Nichts-Verhalten, erwächst aus der verlängerten Regenerationsphase nicht selten ein manifestes Chronisches Erschöpfungssyndrom.
Wir können dieses Phänomen aktuell wieder im Rahmen der Long-Covid-Debatte beobachten: Nicht selten sind es beruflich ambitionierte Menschen oder (Semi-)Profisportler, die sich in symptomärmeren Phasen überlasten (z.B. um wieder fit für Wettkämpfe zu werden), anschließend tage- oder wochenlang pausieren müssen, um einige Monate später mit noch häufigeren und stärkeren Beschwerden zu kämpfen ...
Das (Over-)Push-Crash-Verhalten ist demnach ein dysfunktionaler Bewältigungsansatz zur Kompensation, welcher das Potenzial hat, verzögerte Regenerationsphasen unseres Körpers in einen dauerhaften Erschöpfungszustand zu verwandeln.
Eine wichtige Lehre aus diesen Studien lautet also: Gib deinem Körper nach einer solchen Infektion die notwendige Ruhe und höre auf die Signale, die er dir sendet! Nichts kann so wichtig sein, dass du dafür deine Gesundheit aufs Spiel setzen solltest: Weder Schule oder Karriere, kein Hausbau und auch kein Halbmarathon oder Kraftdreikampf.
Ich weiß, dass das sehr hart klingt. Doch als ehemals schwer von CFS, MCAS und Colitis betroffener leidenschaftlicher Sportler kann ich dir eines mit Sicherheit sagen: Richtig bescheiden wird es erst, wenn du regelmäßig in der Notaufnahme landest, dich auf den Bürgersteig übergibst, dein Studium schmeißen musst und für Jahre erst einmal gar keinen Sport mehr treiben kannst. Du kannst mir da also wirklich vertrauen ...

Alles-oder-Nichts-Verhalten torpediert deine Regeneration und verschlimmert deine Fatigue
Ein Forscherteam der Universität Leiden beobachtete 144 CFS-Patienten über 12 Monate, um die Auswirkungen von Überzeugungen, körperlicher Aktivität und Aktivitätsmustern auf deren Beschwerden zu untersuchen[15]. Zu diesem Zweck wurden die gesammelten Daten in vier separaten hierarchischen Regressionsmodellen verwertet. Bei den Probanden handelte es sich diesmal wohlgemerkt ausschließlich um Patienten, welche bereits die Diagnose Chronisches Erschöpfungssyndrom nach den Kriterien des Centers for Disease Control (CDC) erhalten hatten[16].
Bezüglich des Alles-oder-Nichts-Verhaltens präsentierten sich die folgenden Erkenntnisse:
- Das Alles-oder-Nichts-Verhalten war ein bedeutender Risikofaktor für stärkere Erschöpfung ein Jahr später. (Und damit im Gegensatz zur körperlichen Aktivität per se, welche sich nicht negativ auf die Fatigue auswirkte.)
- Zusätzlich beeinflusste das Alles-oder-Nichts-Verhaltensmuster die körperliche Funktionsfähigkeit (ein Konstrukt verschiedener CFS-Symptome) negativ.
Es handelt sich beim Push-Crash-Muster also tatsächlich um einen dysfunktionalen Bewältigungsstil, welcher Erschöpfungssymptome triggern und eine schlechtere Krankheitsprognose wahrscheinlicher machen kann. Und eigentlich ist das auch vollkommen logisch: Wenn du bei einer Erkrankung wie CFS/ME, welche ohnehin durch eine geringere Energieverfügbarkeit (Mitochondriopathie) und eine mangelnde Regenerationsfähigkeit (Post Exertional Malaise, PEM) gekennzeichnet ist, regelmäßig deine individuellen Belastungsgrenzen überschreitest, dann kann das nur zu deinem Nachteil sein. Nicht wenige meiner Leser und Klienten berichten dazu passend, dass die Crash-Phasen mit jeder Wiederholung intensiver werden und auch länger anhalten ...
Gern möchte ich auch noch den therapeutischen Beleg für die Hypothese des heutigen Artikels anführen: Die Kognitive Verhaltenstherapie (eine Form der Psychotherapie) ist eines der hilfreichsten Mittel gegen CFS. Sie reduziert nachweislich die Erschöpfung, verbessert die körperliche und psychologisch-kognitive Funktionsfähigkeit und lindert krankheitsassoziierte Ängste und depressive Verstimmungen[17]. Reanalysen klinischer Studien belegen eindeutig, dass Teile dieser positiven Effekte auf die Abminderung des Alles-oder-Nichts-Verhaltens zurückzuführen sind[18][19]. Gelingt es dir also, deine Neigung zum phasenweisen Überanstrengen in den Griff zu bekommen, wirst du dafür mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch ein besseres Wohlbefinden, eine höhere Symptomstabilität und letztlich günstigere Prognose für eine Genesung belohnt! Klingt doch vielversprechend genug, um es einmal auszuprobieren, oder?
Warum diese Infos für Menschen mit Darmerkrankungen, MCAS etc. so relevant sind
Ob es den Patienten also gefällt oder nicht: Die Erschöpfung im Rahmen von CFS/ME und Fibromyalgie sowie von Reizdarm, Crohn, MCAS etc. hat geteilte Ursachen, Pathomechanismen und auch Lösungen! Ansätze, die sich bei CFS/ME oder Long Covid bewährt haben, sind also meistens auch für erschöpfte Reizdarmpatienten fruchtbar. Zur Illustration dieser Hypothese eignet sich unser Alles-oder-Nichts-Verhalten ganz hervorragend.
Alles-oder-Nichts-Verhalten begünstigt Erschöpfung bei Darmerkrankungen - unabhängig von der Krankheitsaktivtät!
Erste Störvariablen leuchteten bereits nach dem ersten Besuch auf, denn CED-Patienten mit chronischer Erschöpfung befanden sich tendenziell eher im aktiven Krankheitsstadium, zeigten stärkere depressive Symptome und wurden eher nicht mit Biologika behandelt. Diese und weitere Confounder flossen demnach nicht in die Regressionsanalyse der Wissenschaftler ein. Vier kognitive bzw. Verhaltensfaktoren sagten dennoch signifikant die Erschöpfung und funktionellen Einschränkungen drei Monate später voraus:
- Alles-oder-Nichts-Verhalten begünstigte sowohl Erschöpfung als auch körperliche Einschränkungen drei Monate später
- Katastrophisieren begünstigte ebenfalls sowohl Fatigue als auch Funktionseinschränkungen drei Monate später
- Fear-Avoidance (Vermeidungsverhalten aus Angst vor negativen Konsequenzen, z.B. PEM) begünstigte verstärkte körperliche Einschränkungen
- Exzessives Ausruhen (Überpacing) begünstigte körperliche Einschränkungen drei Monate später
Interessanterweise wirkten sich mehrere kognitive Muster nicht signifikant auf die Outcomes aus, welche auf den ersten Blick durchaus das Potenzial hierzu gehabt hätten. Dazu gehörten bspw. eine übermäßige Symptomfokussierung, Damage Beliefs oder auch die Vermeidung schambehafteter Ereignisse.
Die Forscher beurteilten diese Ergebnisse als enorm wichtig für die klinische Praxis. Sie betonten noch einmal, dass ein Großteil der Patienten auch in der labormedizinischen und strukturellen Remissionsphase unter Erschöpfungszuständen leide, aber nach der Therapie der vermehrten Entzündung kaum Mittel und Wege zur Verfügung stünden, um diesen Patienten adäquat zu helfen. Hier sehen sie eine erste Psychoedukation durch Gastroenterologen und evtl. eine aktivitätssteuernde Psychotherapie als Mittel der Wahl, um die oben beschriebenen Denk- und Verhaltensmuster anzugehen.

In einer weiteren Untersuchung am King´s College unternahmen 780 Probanden mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen eine digitale Intervention zur Linderung ihrer Beschwerden[24]. Doch wie Wissenschaftler nun einmal sind: Fallen diesen erst einmal große Datenmengen in die Hände, ist kaum noch etwas vor ihnen sicher ...
In diesem Fall nutzten sie die Angaben der Patienten, um Symptomprofile zu erstellen (moderat, hoch, schwer). In diesen spielte die chronische Erschöpfung eine ausschlaggebende Rolle. Anschließend versuchten sie via mehrerer Regressionsmodelle jene Faktoren zu bestimmen, welche die Wahrscheinlichkeiten, zu einem spezifischen Symptomprofil zu gehören, minimieren oder erhöhen. Machen wir es diesmal kurz und schmerzlos, um den Artikel nicht noch weiter in die Länge zu ziehen:
- Wider Erwarten wirkte sich der Entzündungsstatus (Calprotectin) nicht auf die Zuordnung zu einem Symptomprofil aus (stärkere Entzündungsprozesse entsprachen also nicht automatisch mehr Schmerz oder mehr Fatigue).
- Bei den biologischen Faktoren erhöhten das weibliche Geschlecht, vorausgegangene Operationen am Darm und Reizdarm-typische Beschwerden (ROM-IV) das Risiko, stärker erschöpft zu sein und mehr Schmerzen zu berichten.
- Bei den psychologischen Variablen sagten insbesondere depressive Zustände, das Alles-oder-Nichts-Verhalten, Fear-Avoidance und Angststörungen schlimmere Erschöpfungzustände und Schmerzen voraus. Das Push-Crash-Muster zeigte dabei nach den depressiven Verstimmungen die zweitstärkste Assoziation!
Dieses Forscherteam konkludiert aufgrund der Ergebnisse, dass es unerlässlich sei, neue Behandlungsstrategien zu entwickeln, welche viel stärker als bisher psychologische Variablen (Denk- und Verhaltensmuster) mit einbeziehen.
Wie könnte eine praktikable Lösung bei Reizdarm, CED, MCAS usw. aussehen?
Grundlegend können wir sagen, dass sich die Darmpatienten auch hier einiges von ihren CFS-Verwandten abschauen können. Pacing lautet das Zauberwort. Es beschreibt das Management körperlicher und kognitiver Aktivitäten, welche immer wieder an das gerade vorhandene Energiereservoir angepasst werden. Hierbei sind zwei Dinge absolut zentral:
- Aktivitäten werden so geplant, dass sie die aktuellen Energiereserven des Patienten nicht überschreiten. Es ist sogar sinnvoll, sich eine Schutzzone von 20% für ungeplante Aktivitäten (bspw. ungeplanter Besuch), veränderte biologische Bedingungen (bspw. schlechter Schlaf) oder Umwelteinflüsse (bspw. Hitze) vorzuhalten. Der Pacingrahmen sollte also nicht jeden Tag gleich aussehen, sondern muss immer wieder neu ausgestaltet und angepasst werden.
-
Geplante sportliche bzw. therapeutische Aktivitäten (von Meditation, über Spaziergänge und Tai Chi, bis hin zu Ergometertraining) innerhalb dieses Fensters sind absoiut
unerlässlich!
- Sie beugen Dekonditionierung und damit unzähligen Begleiterkrankungen vor (vor allem kardiovaskulären).[25]
- Sie vermindern langfristig Fatigue, verbessern die Funktionsfähigkeit des Körpers und haben dabei nicht mehr Nebenwirkungen als passive Therapien.[26]
- Sie haben das Potenzial, die Belastungsgrenze (exercise capacity) systematisch weiter nach oben zu verschieben.[27][28]
Leider muss ich immer wieder feststellen, dass oft nur die erste Seite der Medaille betont wird. Pacing verkommt dann häufig zum Nichts- oder Nur-das-Notwendigste-Tun. Doch wie du bereits weiter oben lesen konntest, begünstigt Überpacing (exzessives Ausruhen) die Erschöpfung sogar und trägt zu negativen Erwartungen bei Belastung bei. Es kommt also auf die perfekte Mischung aus Be- und Entlastung an. Pacing und graduelle Bewegungstherapie schließen sich keinesfalls aus. Im Gegenteil: Sie befruchten sich gegenseitig und führen nur in Einheit zum bestmöglichen Ergebnis.
Oder, wie es eine Forschungsarbeit der Universität Maastricht ausdrückt: Aktivitätsvermeidung, aber nicht Aktivitätspacing, ist mit Invalidität und körperlichem Abbau assoziiert[29].
Dass die Pacing-Strategie und damit die Vermeidung des Alles-oder-Nichts-Verhaltens zum Management der Fatigue ganz wunderbar geeignet ist, zeigen beispielhaft Studien im Rahmen massiv erschöpfter Krebs-, Fibromyalgie-, Long Covid- und natürlich CFS-Patienten[30][31]. Doch auch für letztere zeigte eine australische Metaanalyse, dass die Pacing-Therapie besonders hilfreich ist, wenn die Patienten angehalten werden, im Rahmen ihrer Energieressourcen ihre Aktivitäten Stück für Stück weiter auszubauen[32]. Diesen Spagat gilt es zu meistern, damit du dich langfristig von der lähmenden Erschöpfung befreien kannst.
Zu diesem Zweck habe ich für meine persönliche Therapie über die Jahre ein Punktesystem entwickelt, um meine Aktivitäten besser managen zu können. Ganz einfach ausgedrückt vergebe ich Punkte für Aktivitäten, die meinem Körper Kraft spenden. Energiezehrende Aktivitäten werden hingegen mit Minuspunkten belegt:
- Pluspunkte (meine persönlichen Energiespender): Mindestens neun Stunden erholsamer Nachtschlaf, Meditation, Atemtherapie, Tai Chi, leichtes Ausdauertraining, eingehaltene Ernährungstherapie am Vortag, Arbeitspausen, leichte Familienaktivitäten (Gesellschaftsspiele, Musik machen ...)
- Minuspunkte (Energieräuber): Schlechter oder zu kurzer Schlaf, Infektionen (auch bereits leichte Erkältungen), Fasten, Kältetherapie, Sauna, Kampfsport, Kraftsport, emotionale Belastungen (z.B. Familienstress), intensive körperliche und auch kognitive Arbeit, zu viel Koffein, Zucker ... (Viele dieser Energieräuber sind Bestandteil meines Alltags und haben langfristig positive Auswirkungen, etwa Kälte, körperliches Training oder Fasten. Es ist nicht Sinn und Zweck des Aktivitätsmanagements diese Dinge zu vermeiden!)
Mein Ziel ist es, jeden Tag eine vernünftige Balance zwischen Energiespendern und -räubern zu garantieren. Hierfür nutze ich verschiedene Strategien. Einerseits kann ich zeitweise Energieräuber meiden, die ich freiwillig in mein Leben hole. So lasse ich das Kampfsporttraining oder Krafttraining sein, wenn ich schlecht geschlafen habe, oder meide meine Kälteeinheiten, wenn ich emotional aufgewühlt bin. Andererseits gleiche ich Energieräuber durch zusätzliche Energiespender aus: Muss ich kognitiv leistungsfähig sein, ergänze ich diese Arbeit vermehrt durch aktive Pausen und eine zusätzliche Einheit Meditation am Morgen, usw.
Die Punktwerte sind extrem individuell. Bei mir persönlich wiegen Schlaf, Emotionen und kleinere Infekte deutlich mehr, während ich körperliche Belastungen inzwischen wieder relativ gut tolerieren kann.
Wenn mich heute jemand beobachtet, wie ich morgens im Dunkeln joggen gehe und anschließend eineinhalb Stunden meine Übungen machen, würde er wohl kaum auf die Idee kommen, dass ich einmal die Diagnosen CFS, MCAS sowie Colitis hatte und kaum die Treppen zu unserer Wohnungstür hinaufkam. Und dennoch brauche ich auch heute noch ein effektives Pacingmodell, um nicht wieder in die Falle des Alles-oder-Nichts-Verhaltens zu tappen.
Natürlich gehören noch deutlich mehr Strategien dazu, als mein kleines Punktesystem. So nutze ich auch festgeschriebene Arbeitszyklen und Pausenzeiten oder zwinge mich an besonders guten Tagen, nach geschafftem Pensum von der Arbeit abzulassen. Das fällt mir nicht immer leicht, aber besonders meine Familie dankt mir für die zusätzliche Zeit zum Spielen, Lachen und Kuscheln.
Über die Feinheiten des Pacings können wir aber in einem eigenen Artikel umfassend sprechen. Nun wünsche ich dir erst einmal viel Erfolg beim Angehen deiner Erschöpfungsproblematik. Ich bin mir sicher, dass auch du das in den Griff bekommen kannst!
Alles Liebe
dein Thomas
Dir hat dieser Artikel gefallen oder sogar weitergeholfen?
Dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du meine völlig kostenfreien Inhalte mit anderen Betroffenen, deren Angehörigen oder Therapeuten teilen könntest. Herzlichen Dank dafür!
Du möchtest das Projekt darüber hinaus unterstützen?
Literaturverzeichnis
1 Kim YJ, Lee SG, Lee JS, Choi YJ, Son CG. Comparative characteristics of fatigue in irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysis. J Psychosom Res. 2024 Feb;177:111589. doi: 10.1016/j.jpsychores.2024.111589. Epub 2024 Jan 6. PMID: 38199049.
2 Lackner JM, Gudleski GD, Dimuro J, Keefer L, Brenner DM. Psychosocial predictors of self-reported fatigue in patients with moderate to severe irritable bowel syndrome. Behav Res Ther. 2013 Jun;51(6):323-31. doi: 10.1016/j.brat.2013.03.001. Epub 2013 Mar 19. PMID: 23578499; PMCID: PMC3741653.
3 Tarar ZI, Farooq U, Nawaz A, Gandhi M, Ghouri YA, Bhatt A, Cash BD. Prevalence of Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome among Individuals with Irritable Bowel Syndrome: An Analysis of United States National Inpatient Sample Database. Biomedicines. 2023 Sep 22;11(10):2594. doi: 10.3390/biomedicines11102594. PMID: 37892968; PMCID: PMC10604744.
4 Han CJ, Yang GS. Fatigue in Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis of Pooled Frequency and Severity of Fatigue. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2016 Mar;10(1):1-10. doi: 10.1016/j.anr.2016.01.003. Epub 2016 Feb 1. PMID: 27021828.
5 El-Salhy M, Winkel R, Casen C, Hausken T, Gilja OH, Hatlebakk JG. Efficacy of Fecal Microbiota Transplantation for Patients With Irritable Bowel Syndrome at 3 Years After Transplantation. Gastroenterology. 2022 Oct;163(4):982-994.e14. doi: 10.1053/j.gastro.2022.06.020. Epub 2022 Jun 14. PMID: 35709830.
6 Versteeg GA, Ten Klooster PM, van de Laar MAFJ. Fatigue is associated with disease activity in some, but not all, patients living with rheumatoid arthritis: disentangling "between-person" and "within-person" associations. BMC Rheumatol. 2022 Jan 7;6(1):3. doi: 10.1186/s41927-021-00230-2. PMID: 34991729; PMCID: PMC8739670.
7 Artom M, Czuber-Dochan W, Sturt J, Murrells T, Norton C. The contribution of clinical and psychosocial factors to fatigue in 182 patients with inflammatory bowel disease: a cross-sectional study. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Feb;45(3):403-416. doi: 10.1111/apt.13870. Epub 2016 Nov 20. PMID: 27868215.
8 Holten KA, Bernklev T, Opheim R, Olsen BC, Detlie TE, Strande V, Ricanek P, Boyar R, Bengtson MB, Aabrekk TB, Asak Ø, Frigstad SO, Kristensen VA, Hagen M, Henriksen M, Huppertz-Hauss G, Høivik ML, Jelsness-Jørgensen LP. Fatigue in Patients with Inflammatory Bowel Disease in Remission One Year After Diagnosis (the IBSEN III Study). J Crohns Colitis. 2025 Apr 4;19(4):jjae170. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjae170. PMID: 39527064; PMCID: PMC12001332.
9 Band R, Barrowclough C, Caldwell K, Emsley R, Wearden A. Activity patterns in response to symptoms in patients being treated for chronic fatigue syndrome: An experience sampling methodology study. Health Psychol. 2017 Mar;36(3):264-269. doi: 10.1037/hea0000422. Epub 2016 Nov 7. PMID: 27819461; PMCID: PMC5327891.
10 Friedberg F, Adamowicz JL, Bruckenthal P, Milazzo M, Ramjan S, Quintana D. Nonimprovement in Chronic Fatigue Syndrome: Relation to Activity Patterns, Uplifts and Hassles, and Autonomic Dysfunction. Psychosom Med. 2022 Jul-Aug 01;84(6):669-678. doi: 10.1097/PSY.0000000000001082. Epub 2022 Apr 14. PMID: 35420586; PMCID: PMC9271593.
11 White PD, Thomas JM, Amess J, Crawford DH, Grover SA, Kangro HO, Clare AW. Incidence, risk and prognosis of acute and chronic fatigue syndromes and psychiatric disorders after glandular fever. Br J Psychiatry. 1998 Dec;173:475-81. doi: 10.1192/bjp.173.6.475. PMID: 9926075.
12 Katz BZ, Shiraishi Y, Mears CJ, Binns HJ, Taylor R. Chronic fatigue syndrome after infectious mononucleosis in adolescents. Pediatrics. 2009 Jul;124(1):189-93. doi: 10.1542/peds.2008-1879. PMID: 19564299; PMCID: PMC2756827.
13 Ruiz-Pablos M, Paiva B, Montero-Mateo R, Garcia N, Zabaleta A. Epstein-Barr Virus and the Origin of Myalgic Encephalomyelitis or Chronic Fatigue Syndrome. Front Immunol. 2021 Nov 15;12:656797. doi: 10.3389/fimmu.2021.656797. PMID: 34867935; PMCID: PMC8634673.
14 Moss-Morris R, Spence MJ, Hou R. The pathway from glandular fever to chronic fatigue syndrome: can the cognitive behavioural model provide the map? Psychol Med. 2011 May;41(5):1099-107. doi: 10.1017/S003329171000139X. Epub 2010 Jul 21. PMID: 20663256.
15 De Gucht V, Garcia FK, den Engelsman M, Maes S. Do changes in illness perceptions, physical activity, and behavioural regulation influence fatigue severity and health-related outcomes in CFS patients? J Psychosom Res. 2017 Apr;95:55-61. doi: 10.1016/j.jpsychores.2017.02.009. Epub 2017 Feb 17. PMID: 28314549.
16 De Gucht V, Garcia FK, den Engelsman M, Maes S. Differences in Physical and Psychosocial Characteristics Between CFS and Fatigued Non-CFS Patients, a Case-Control Study. Int J Behav Med. 2016 Oct;23(5):589-94. doi: 10.1007/s12529-016-9544-0. PMID: 26895839; PMCID: PMC5031722.
17 Maas Genannt Bermpohl F, Kucharczyk-Bodenburg AC, Martin A. Efficacy and Acceptance of Cognitive Behavioral Therapy in Adults with Chronic Fatigue Syndrome: A Meta-analysis. Int J Behav Med. 2024 Dec;31(6):895-910. doi: 10.1007/s12529-023-10254-2. Epub 2024 Jan 16. PMID: 38228869; PMCID: PMC11588766.
18 Cella M, White PD, Sharpe M, Chalder T. Cognitions, behaviours and co-morbid psychiatric diagnoses in patients with chronic fatigue syndrome. Psychol Med. 2013 Feb;43(2):375-80. doi: 10.1017/S0033291712000979. Epub 2012 May 9. PMID: 22571806.
19 Chalder T, Goldsmith KA, White PD, Sharpe M, Pickles AR. Rehabilitative therapies for chronic fatigue syndrome: a secondary mediation analysis of the PACE trial. Lancet Psychiatry. 2015 Feb;2(2):141-52. doi: 10.1016/S2215-0366(14)00069-8. Epub 2015 Jan 28. PMID: 26359750.
20 Borren NZ, van der Woude CJ, Ananthakrishnan AN. Fatigue in IBD: epidemiology, pathophysiology and management. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019 Apr;16(4):247-259. doi: 10.1038/s41575-018-0091-9. PMID: 30531816.
21 Truyens M, Lernout H, De Vos M, Laukens D, Lobaton T. Unraveling the fatigue puzzle: insights into the pathogenesis and management of IBD-related fatigue including the role of the gut-brain axis. Front Med (Lausanne). 2024 Jul 3;11:1424926. doi: 10.3389/fmed.2024.1424926. PMID: 39021817; PMCID: PMC11252009.
22 Uhlir V, Stallmach A, Grunert PC. Fatigue in patients with inflammatory bowel disease-strongly influenced by depression and not identifiable through laboratory testing: a cross-sectional survey study. BMC Gastroenterol. 2023 Aug 22;23(1):288. doi: 10.1186/s12876-023-02906-0. PMID: 37608313; PMCID: PMC10463723.
23 Moulton CD, Jordan C, Hayee B, Chalder T. All-or-Nothing Behavior and Catastrophic Thinking Predict Fatigue in Inflammatory Bowel Disease: A Prospective Cohort Study. Inflamm Bowel Dis. 2024 Oct 3;30(10):1903-1906. doi: 10.1093/ibd/izad193. PMID: 37619243; PMCID: PMC11447110.
24 Wileman V, Chilcot J, Norton C, Hart A, Miller L, Stagg I, Seaton N, Pollok R, Aziz Q, Moss-Morris R. Modifiable Psychological Factors are Associated With Clusters of Pain, Fatigue, Fecal Incontinence, and Irritable Bowel Syndrome-Type Symptoms in Inflammatory Bowel Disease: A Latent Profile Analysis. J Crohns Colitis. 2025 May 8;19(5):jjae183. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjae183. PMID: 39656929; PMCID: PMC12087568.
25 De Lorenzo F, Xiao H, Mukherjee M, Harcup J, Suleiman S, Kadziola Z, Kakkar VV. Chronic fatigue syndrome: physical and cardiovascular deconditioning. QJM. 1998 Jul;91(7):475-81. doi: 10.1093/qjmed/91.7.475. PMID: 9797930.
26 Cooper C, Papadopoulos K. Evaluating pacing therapy (PT) versus graded exercise therapy (GET) for improving fatigue, pain, and quality of life in adults with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS): A systematic review. J Bodyw Mov Ther. 2025 Oct;44:319-327. doi: 10.1016/j.jbmt.2025.05.048. Epub 2025 May 30. PMID: 40954597.
27 De Vera Martín A, Salazar AD, Pérez IMM, Pérez SEM. Effectiveness of Exercise-Based Rehabilitation in Chronic Fatigue Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Exerc Sci. 2025 May 1;18(5):495-530. doi: 10.70252/DAYA4589. PMID: 40485841; PMCID: PMC12143281.
28 Fulcher KY, White PD. Strength and physiological response to exercise in patients with chronic fatigue syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000 Sep;69(3):302-7. doi: 10.1136/jnnp.69.3.302. PMID: 10945803; PMCID: PMC1737090.
29 Karsdorp PA, Vlaeyen JW. Active avoidance but not activity pacing is associated with disability in fibromyalgia. Pain. 2009 Dec 15;147(1-3):29-35. doi: 10.1016/j.pain.2009.07.019. Epub 2009 Aug 27. PMID: 19716234.
30 Getu MA, Wang P, Addissie A, Seife E, Chen C, Kantelhardt EJ. The effect of cognitive behavioural therapy integrated with activity pacing on cancer-related fatigue, depression and quality of life among patients with breast cancer undergoing chemotherapy in Ethiopia: A randomised clinical trial. Int J Cancer. 2023 Jun 15;152(12):2541-2553. doi: 10.1002/ijc.34452. Epub 2023 Feb 28. PMID: 36744446.
31 Antcliff D, Keenan AM, Keeley P, Woby S, McGowan L. Testing a newly developed activity pacing framework for chronic pain/fatigue: a feasibility study. BMJ Open. 2021 Dec 8;11(12):e045398. doi: 10.1136/bmjopen-2020-045398. PMID: 34880007; PMCID: PMC8655535.
32 Casson S, Jones MD, Cassar J, Kwai N, Lloyd AR, Barry BK, Sandler CX. The effectiveness of activity pacing interventions for people with chronic fatigue syndrome: a systematic review and meta-analysis. Disabil Rehabil. 2023 Nov;45(23):3788-3802. doi: 10.1080/09638288.2022.2135776. Epub 2022 Nov 8. PMID: 36345726.
